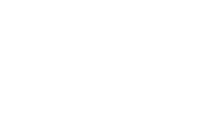Betrug und Selbstbetrug in der Hochschulpolitik
Ein Rückblick nach vorn
Meine Damen und Herren,
die Parteien, die Regierungen, die Oppositionen, die Wirtschaft, Gewerkschaften, die Kirchen, die Professoren und die Medien sind auf Ihrer Seite. Der Bundeskanzler steht an der Spitze der Streikbewegung. Aber Sie können davon ausgehen, daß viele, die Ihnen heute zustimmen, Sie morgen betrügen werden. Dies steht schon fest.
Betrug ist ein Strukturmerkmal des Kampfes um Macht: Man macht Versprechungen, kassiert Vertrauen, Zustimmung und Sympathie, und wenn man dies bekommen hat, können die Versprechen gebrochen werden. Betrügerische Hochschulpolitik hätte aber viel weniger Chancen, wenn die Angehörigen der Universität nicht eine besondere Disposition zum Selbstbetrug hätten. Professoren und Studierende neigen zum Selbstbetrug. Dies liegt in der Struktur ihrer Tätigkeit, die geistige Arbeit ist und ohne ein idealistisches Element gar nicht funktioniert. Der Idealismus ist - auch hier sage ich Ihnen nichts neues - die höchste, aber auch die schönste und edelste Form des Selbstbetrugs.
Die Beispiele für die Neigung von Hochschulangehörigen zum Selbstbetrug liegen auf der Hand. So müssen sich z. B. Professoren, die die Idee der Wertfreiheit der Wissenschaft verteidigen, selbst betrügen. Sie müssen sich selbst heftig einreden, daß sie nur neutrale Tätigkeiten verrichten, die als solche weder regierungs- noch oppositionsfreundlich oder -feindlich eingestellt, d.h. eben politisch sind. Es ist dies eine sehr edle Form professoralen Selbstbetrugs, es gibt mindere.
Das Beispiel für die Neigung von Studierenden zum Selbstbetrug liegt heute auf der Hand: wenn Sie sagen, Sie streiken. Studierende können demonstrieren, protestieren, sich zu Provokationen hinreißen lassen, aber sie können nicht streiken, weil sie nicht erwerbstätig sind. Nun weiß ich natürlich, daß „Studierendenstreik“ meint, hier wird ein Traditionselement der europäischen Arbeiterbewegung metaphorisiert. Es ist ein Streik in einem symbolischen, einem übertragenen Sinne. Der Selbstbetrug setzt ein, wenn man Symbol für Realitäten hält. Der alte gewerkschaftliche Vers „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“ ist für Studierende nicht übersetzbar. Denn Ihr Streik schadet logischerweise nur Ihnen, weil die Streiklogik darauf berechnet ist, daß der Bestreikte materiell erpreßt werden kann. Immerhin ist der Studierendenstreik die edelste Form, sich selbst zu betrügen, die Studierende zeigen können. Es gibt mindere Formen, über die ich jetzt nicht sprechen möchte.
Sie sehen, ich gehöre zu den kritischen Sympathisanten dieses Streiks. Ich glaube, das altarbeiterbewegte Streikmodell hat für Unis ausgedient. Wenn Sie in diesem Meer von Zustimmung nicht ertrinken wollen, brauchen Sie viele neue Ideen, wie Sie Ihre Macht kontinuieren können. Jetzt ist Ihre Macht nur Aktionsmacht. Sie ist, so lange Sie Aktionen machen. Viele, die Ihnen jetzt zustimmen, warten darauf, daß Sie Ihren Höhepunkt erreichen, daß Sie dann müde werden, daß Sie sich in die Durchhalte-Streik-Terminologie eingehaust haben und wie Gewerkschaften davon reden: „Die Streikfront bröckelt“. So wie ich die Sache sehe, streiken Sie gar nicht. Sie stehen früher auf als sonst. Sie produzieren mehr Intelligenz als sonst. Sie haben sich Ihre Uni-Räume angeeignet, um autonom, selbstorganisiert, autopoietisch ein Verständnis Ihrer Lage zu erarbeiten und Demonstrationen aller Art vorzubereiten. Die entscheidende Frage ist nicht, wie lange Sie das durchhalten, sondern wann Sie das wieder machen. Bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig - das war auch kein Streik - war es immer montags. Vielleicht entwickeln Sie Ideen für eine Zeitstruktur des Protests, die nicht apokalyptisch ist, sondern praktisch, d.h. für Politik und Protest und Studium innovativ ist.
Zurück zur Disponiertheit zum Selbstbetrug bei Hochschulangehörigen. Sie könnte bei uns durch gewisse Chancen, die in geistiger Tätigkeit liegen, ein Stück weit kompensiert werden. Wir könnten unsere geschulten Köpfe benutzen, um uns zu erinnern und aus Erfahrungen zu lernen. Aber die Tragik der Universität besteht gerade darin, daß wir zwar artistische Behaltensleistungen für Prüfungen und Klausuren oder für tiefschürfende Forschungen erbringen, aber Weltmeister im Vergessen von Betrug und Selbstbetrug in der Hochschulpolitik sind. Diese politische Geistesabwesenheit der Universitäten bildet das Fundament der Politik der Regierungen. Diese politische Geistesabwesenheit der Universitäten ist eine andauernde Einladung, diese Institution auszuplündern. Dagegen helfen nur Rückblicke nach vorn und keine Schwamm-drüber- oder Talk-Show-drüber-Mentalität, die sich weigert, die Schulden von gestern zu bezahlen.
Es gibt nun sehr starke Tendenzen, Sie auf einen Rückblick auf 1968 zu verpflichten. Ich habe dazu vor der Fachschaft Geschichte vor 14 Tagen das Nötige gesagt (Wolfgang Eßbach, Protestbewegung, Scheinrevolution, postmoderne Revolte? Nachdenken über ‘68. Ein Vortrag, 19. November 1997, unveröffentlicht, Manuskript kann auf Anfrage versandt werden). Wer Sie mit ‘68 so oder so vergleicht, will Ihre Position delegitimieren. Denn ‘68 ist ein politischer Mythos. Vergleiche mit mythischen Phänomenen gehen generell für die Gegenwart schlecht aus. Jedes familiengründende Paar, das sich mit Adam und Eva vergleicht, steht schlecht da. So funktionieren Mythen. Für jede Gruppe oder Bewegung, die etwas verändern will, ist zuerst der Rückblick auf die letzten Anstrengungen nötig. Die letzten nennenswerten Studentenproteste, Streiks, Boykotts von Lehrveranstaltungen, Besetzung von Gebäuden fanden in der BRD 1988/89 statt, in Freiburg fast auf die Woche genau vor neun Jahren. Wenn Sie also etwas bewirken wollen, tun Sie gut daran, Positionen und Kräfteverhältnisse, Aktionen und Effekte dieser letzten großen Proteste an deutschen Universitäten genau zu studieren. Es gibt gottseidank noch Studierende im 18. Semester, die damals dabei waren, die Sie fragen können.
In meinem Beitrag zu diesem Marathon kann ich nur kurz die damalige Situation skizzieren. Dann werde ich Ihnen den verfassungsrechtlichen Abschluß der 68er-Bewegung, die Bundesverfassungsgerichts-Urteile zum NC und zur Drittelparität vorstellen, weil sie der hochschulpolitische Handlungsrahmen des letzten Vierteljahrhunderts gewesen sind. Dann werde ich auf den Winter 1988/89 zurückkommen und über die 90er Jahre sprechen.
Vor neun Jahren, im Dezember 1988, fanden an allen Universitäten Streiks, Demonstrationen und Boykotte statt, um auf die Lage an den Universitäten aufmerksam zu machen. Am 14. Dezember 1988 wurde das Kollegiengebäude IV besetzt. Über Nacht fand ein sleep-in statt. Am Morgen fanden sich sinnige und sinnlose Sprüche und Farbbemalungen an Wänden, Fenstern, Teppichböden. Alle Sachschäden zusammengerechnet: 100 000 DM. Der damalige Rektor sprach von einem „sinnlosen Akt des Vandalismus“. Die Aktionen gingen weiter. Am 17. Januar 1989 wurde das Deutsche Seminar besetzt. Der Flugblatt-Text:
„Seit zwölf Uhr ist das Deutsche Seminar besetzt (KG III/2/3/4 OG). Um die lähmende nachweihnachtliche Lethargie aufzubrechen und um das ungute Gefühl, auf den Sankt Nimmerleinstag vertröstet zu werden, zu durchbrechen, haben wir mit dieser Aktion begonnen. Dieses Institut bietet uns geeignete Räume für Plenen und Feten (Kopfraum), für autonome Seminare (zwei große Arbeitsräume), für Veranstaltungen und diverse AGs/AKs-Sitzungen (mehrere kleine und mittelgroße Räume). Bisher waren uns die Möglichkeiten, unsere Inhalte und Themen selbstbestimmt zu diskutieren, nicht gegeben. Daher beginnen wir jetzt selbst, in die Hand zu nehmen, wo wann was wie geschieht. Wir sehen die Besetzung des Deutschen Seminars als einen ersten Schritt, uns unsere Zeit anzueignen und einen Austausch und die Koordinierung dessen, was sich bisher ereignet hat, zu ermöglichen und sichtbar zu machen. Die verschiedenen AGs/AKs, die sich in der Boykottwoche gegründet haben, können sich hier treffen, ihre Arbeit vorstellen und öffentlich diskutieren. Alle sollen ihre Interessen, Wünsche und ihren UN(i)MUT einbringen. Daß dies möglich ist und nicht nur Streß, zeigen die StudentInnen der anderen bestreikten Unis, wie Berlin, Tübingen, Gießen etc. Auf diese Weise kann eine Struktur entstehen, die dem Boykott über einen begrenzten Zeitraum und partielle Forderungen hinaus eine Perspektive schafft.“
Auf der Rückseite des Flugblatts dann das Programm:
„Dienstag, 17.1.89
12.00 Uhr Besetzung
13.30 Uhr Plenum (Kopfraum)
15.00 Uhr Autonome Seminare und organisatorische Ags (Zeiten und Orte siehe Aushang)
15.00 Uhr Bericht aus Berlin mit Streikvideos und Diskussion
16.00 Uhr Reservisten an der Freiburger Uni. Bericht und Diskussion
16.00 Uhr Aufstand der Waschlappen. Eine Kritik der Bewegung
18.00 Uhr Plenum (Kopfraum)
20.00 Uhr Wohnungsnot-Plenum
Abends: Fest mit abschließendem Schlafsackhüpfen“
Am Mittwoch ging es so weiter und für Donnerstag notierte das Flugblatt als Programm: „Hängt von Eurer Initiative ab“.
Es gab etliche Aktivitäten, die von verschiedenen Instituten und Seminaren ausgingen. Teils liefen auch Seminare weiter. Was nicht gelang, war, den Rythmus von ordentlichem Lernen und außerordentlichem Lernen bewußt zu gestalten. Es gelang auch nicht, die Idee abwechselnder Institutsbesetzungen und Aktionswochen weiter zu entwickeln. Die engagierteren Studierenden empfanden sich schließlich am Ende des Wintersemesters in traditioneller Manier als letzte Mohikaner eines abbröckelnden Boykotts, obwohl die Zahl der aufgewachten Studierenden objektiv viel größer geworden war. Daraufhin organisierte der u-AStA für den 22. bis 26. Mai 1989 einen Kongreß Freiburger Frühling. Ich lese Ihnen aus der Einladung:
„StudentInnen-Unmut 1988 - das waren viele verschiedene Aktionen und praktisch keine Konzepte für ein eigenes Uni-Modell, mit dem die politisch Verantwortlichen konfrontiert werden konnten. Die urplötzlich hereingebrochene Diskussion über finanzielle Forderungen, Studieninhalte und studentische Mitbestimmung flaute 1989 genauso schnell wieder ab, wie sie 1988 aufgekommen war. Der studentische Protest schien in einen Winterschlaf zu verfallen, den nur ein Frühling erwecken konnte. Um den Diskussionsansätzen des Wintersemesters eine Perspektive zu geben, aber auch um den studentischen Protest aus dem universitären Ghetto auszuführen, wurde die Idee des FREIBURGER FRÜHLING geboren. Nun ist es soweit: eine Woche lang sollen studentische Forderungen konkretisiert und ein Stück Gegen-Uni demonstriert werden. (...) So will der FREIBURGER FRÜHLING keinen Schlußpunkt hinter die studentischen Disussionen des Wintersemesters setzen, sondern ein Anfang sein, ein neuer Impuls für eine StudentInnen-Bewegung, die sich ihrer sozialen, ökologischen und demokratischen Verantwortung bewußt ist.“
Die Woche wurde ein voller Erfolg, die Zahl der politisch aufgewachten Studierenden wuchs noch einmal. Die autonomen Seminaren konnten im Vergleich mit den offiziellen Lehrveranstaltungen oft besser abschneiden.
Wie war die Situation vor einem Jahrzehnt? Sie war für Proteste günstiger als heute, weil damals die Erinnerungsfähigkeit der Hochschulangehörigen noch stärker ausgebildet war. 1988 erinnerten sich die Rektoren der westdeutschen Universitäten, daß sie vor wiederum zehn Jahren, 1977, beschlossen hatten, die Universitäten trotz der extremen Überfüllung offenzuhalten. Die Professoren akzeptierten eine sogenannte „Überlastquote“, bis der Staat mit dem Ausbau der Universitäten nachgekommen sein sollte und die Studentenzahlen zurückgingen.
Dieser 77er-Beschluß der deutschen Professoren war ihr Beitrag zur Zerstörung der Universität. Das wurde 1988 klar. In zehn Jahren Überlastquote hatte sich die Zahl der Studienanfänger um 73 Prozent, die Zahl der Lehrenden um 7 Prozent vermehrt. 1988 bildete sich zaghaft eine Mehrheit in der Rektorenkonferenz, die bereit war, die Überlast-Vereinbarung mit den Regierungen zu kündigen, und eine Revision der auf Überlast ausgerichteten Kapazitätsverordnungen vorzunehmen. Es standen Drohungen im Raum, einzelne Fachbereiche zu schließen, weil dort ein ordnungsgemäßes Studium nicht möglich war. Auch diejenigen Professoren, die stolz auf ihre Mammut-Seminare waren, wo sie 90 Prozent der 50 bis 150 Teilnehmer überhaupt nicht kannten, geschweige denn eine Leistung kontrollierten, ein feed-back jemals gegeben haben ... auch die für offenhalten und weitermachen waren, wurden nachdenklich. Seit Mitte der 70er Jahre war die Zuweisung pro Student Jahr für Jahr real abgebaut worden. Der Hochschullehrer-Nachwuchs war arbeitslos. Hochschulbau fand kaum noch statt. So waren auch für viele Professoren die Studentendemonstrationen 1988/89 eine Hoffnung auf eine Wende in der Hochschulpolitik.
Um die Krise der 80er Jahre zu verstehen, muß man zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile kennen, mit denen die 68er-Bewegung ihr hochschulrechtliches Ende fand. BVG-Urteile sind für die Bundesrepublik immer enorm wichtig. Hüter der Verfassung ist nicht das Volk, von ihm geht nur alle Staatsgewalt aus. Hüter der Verfassung sind die Verfassungsrichter in den roten Talaren in Karlsruhe. Da ‘68 in hochschulpolitischer Hinsicht ein Konflikt zwischen der Mehrheit der Professoren einerseits und Studenten und Assistenten andererseits war, gaben die Karlsruher Richter in zwei Urteilen jeder Seite einmal recht. Diese Urteile sind bis heute der verfassungsrechtliche Rahmen aller Hochschulpolitik. Was es aber vor allem zu erinnern gilt, ist: sie haben eine sehr zwiespältige und fatale Dynamik eröffnet. Um es kurz zu machen: Ein Urteil erging zum Komplex Bildung für alle, hier bekamen die Studenten recht. Das andere Urteil zum Komplex Demokratisierung der Universität, hier bekamen die Professoren recht. Heute, nach einem Vierteljahrhundert, kann ich sagen: Ach! Hätten sie doch umgekehrt entschieden: im Numerus-Clausus-Urteil den Professoren rechtgegeben, im Mitbestimmungs-Urteil den Studierenden.
Zum BVG-Urteil zur Demokratisierung der Universität, d.h. der Mitbestimmung von Assistenten und Studierenden, ist zu sagen: Studentische Forderung der 60er Jahre war, alle drei funktionalen Gruppen, nämlich Studierende, der sogenannte Mittelbau (d.h. der angestellte wissenschaftliche Nachwuchs zwischen erstem Examen und Bestellung zum Professor) und die Professoren sollten in Universitätsgremien gleiches Stimmrecht haben: ein Drittel Studierende, ein Drittel Mittelbau, ein Drittel Professoren. Drittelparität nannte man das. Ich selbst habe zusammen mit Detlev Albers und Gerd Hinnerk-Behlmer an diesen Modellen mitgearbeitet (die beiden kennen Sie übrigens alle von dem Photo mit dem berühmt-berüchtigten Transparent „Unter den Talaren ...“). Die Idee der Drittelparität wurde auch von Landesregierungen aufgegriffen. Genauer gesagt: Wir hochschulpolitisch interessierten Studenten forderten die Politiker auf, Hochschulgesetze zu erlassen, in denen Reformen fixiert würden. Dieser Ruf nach Hochschulgesetzen von studentischer Seite war ein schwerer Fehler. Es war dies der größte hochschulpolitische Selbstbetrug, den ich mir zurechnen muß. Der Ruf nach Hochschulreformgesetzen war der Beitrag der deutschen Studierenden zur Zerstörung der Universität. Denn damit wurde ein Akteur in die Hochschulen hereingeholt, nämlich die jeweilige Regierungspartei, die kein strukturelles Hauptinteresse an Universitäten hatte, und die von den Universitäten so viel verstand wie von Mittelpersisch oder von Quarks, nämlich gar nichts. Es war Selbstbetrug zu glauben, inneruniversitäre Konflikte durch Politiker entscheiden zu lassen helfe der Universität. Zuerst waren Wissenschaftsminister oft interessierte Professoren, später wurden es Gestalten, die ohne innere Bindung an die Universität Hochschulpolitik für ihre Zwecke, die naturgemäß ganz außerhalb der Universitäten lagen, funktionalisierten und so im Effekt die Hochschulen chaotisierten.
Zurück zum BVG-Urteil zur Mitbestimmung. Anfang der 70er Jahre hatte das Verfassungsgericht im Normenkontrollverfahren unter anderem über das niedersächsische Hochschulgesetz zu entscheiden, das eine so weitgehende Beteiligung von Studierenden und Assistenten in Gremien vorsah, daß Professoren rein rechnerisch in Gremien in die Minderheit geraten konnten. Karlsruhe entschied zugunsten der Professoren, gegen Staat und Studenten, so war damals die Lage der Streitparteien. Die Richter hatten auszulegen, wie Art. 5 Abs. 5, 3 GG: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung“ auszulegen sei. Gilt Wissenschaftsfreiheit für alle Angehörigen der Universität oder nur für Professoren? Handelt es sich um eine institutionelle Garantie für die Universitäten als Stätten der Wissenschaft oder ist es die Garantie für eine Berufsgruppe, die Professoren?
Karlsruhe entschied gegen die Drittelparität, für das alleinige Stimmrecht von Professoren in Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Bis heute haben Assistenten und Studenten nur eine mitberatende, keine mitentscheidende Stimme. Damit wurde, was bisher nur Tradition war, die Ordinarien-Universität, als eine Professoren-Universität höchstrichterlich fixiert. Damit waren aber zugleich auch inhaltliche und strukturelle Reformrechte auf die Gruppe der Professoren beschränkt. Weder Assistenten noch Studenten hatten inneruniversitäre Macht, etwas zu bewegen. Aber - und dies wird erst Jahrzehnte später sichtbar - auch die Regierungen mußten vor dem Professoren-Privileg halt machen. Sie hatten inhaltlich nichts zu sagen und waren auf andere Felder verwiesen, wenn sie auf die Hochschulen einwirken wollten. Mit der Ablehnung der Drittelparität wurde ein inneruniversitärer Reformmechanismus stillgestellt: keine Evaluation der Professoren, keine Studienreform, Restauration der Vor-68er-Strukturen. Hätte Karlsruhe in dieser Frage anders entschieden, dann hätten sich Professoren bei den Assistenten und Studenten Bündnispartner suchen müssen. Die gegenseitige Angewiesenheit der drei funktionalen Gruppen der Universität hätte - so wie ich es sehe - das kommende Desaster durchaus verhindern können. Interaktive Evaluation und eine funktionierende Verantwortlichkeit der Universität gegenüber gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Ansprüchen außerhalb ihres Bereichs wäre schon in den siebziger Jahren möglich gewesen, wenn die Zukunft der Wissenschaft, die nunmal in Assistenten verkörpert ist, und die Bildungs- und Ausbildungsinteressen, die nunmal in werdenden Hochschulabsolventen verkörpert sind, Stimmrechte bekommen hätten. Mit Karlsruhe im Rücken konnten Professoren gegen Interessen von Assistenten und gegen Interessen von Studierenden ohne institutionellen Kooperationszwang tun, was sie wollten. Daraus erwuchsen etliche Blüten hochschulpolitischen Selbstbetrugs und Betrugs von Professoren, die das allgemeine Image des deutschen Professors in der Öffentlichkeit so ungemein anziehend machen. Wer heute Professorenschelte betreibt – die Zeitungen sparen da ja nicht – muß wissen, daß gegen die Forderung von ‘68 nach Drittelparität die Karlsruher Richter die gesamte Universität den Professoren ausgeliefert haben. Professoren, die das noch toll finden, betrügen sich selbst, denn es gibt für die Wissenschaft wissenschaftsfeindlichere Partner als die eigenen Assistenten und Studenten.
Die Karlsruher Richter hatten noch eine zweite Frage zu entscheiden, und da gaben sie den Studenten recht, die Bildung für alle forderten. Durften Universitäten oder Regierungen frei bestimmen, wieviele Studierende zum Studium zugelassen werden? Es ging um die Bedingungen für den Numerus Clausus. Die Richter entschieden, die Universitäten dürfen nicht aus Gründen der Steigerung der Qualität der Forschung und Lehre oder aus Gründen des Erhalts der Qualität die Zulassung zum Studium verweigern. Bei einer Übernachfrage nach Studienplätzen seien die Universitäten so erschöpfend zu nutzen, daß sie eine gerade noch ausreichende Ausbildung vermitteln. Erst wenn das nicht möglich sei, dürfte die Zulassung beschränkt werden. Seit 1972 gilt dieser Mechanismus der programmierten Qualitätsminderung der Studienbedingungen. Standard bei der tatsächlichen 25-jährigen Übernachfrage nach Studienplätzen in Massenfächern ist immer gerade noch ausreichend, also vier minus gewesen. Alle Klagen über das schlechte Niveau, alles Qualitätsgerede haben hier ihren Wurzelgrund. Wer als Lehrender mit 25 Studierenden zusammenarbeitet, kann sie weiter bringen als jemand, der mit 100 zusammenarbeitet. In der Freiburger Soziologie arbeiten sechs hauptamtliche Personen mit je 133 Studierenden. Wenn sie nur Professoren rechnen, arbeiten nach der Streichungsrunde dieses Jahres jetzt zwei Professoren mit je 400 Studierenden. Wir dürfen aber nicht zur Verbesserung der Qualität den Numerus Clausus erhöhen, weil wir damit in die Luxuszone einer mehr als gerade noch ausreichenden Ausbildung kämen.
Wenn Sie die Entwicklung der deutschen Hochschulen in den letzten 25 Jahren verstehen wollen, dann müssen Sie die Wirkung der beiden Bundesverfassungsgerichtsurteile zusammennehmen. Einmal war es die Ausschaltung von Nicht-Professoren-Interessen aus der Selbstverwaltung, kein Rechtfertigungsdruck auf Hochschullehrer, keine Not ihrer Entscheidung gegenüber Absolventeninteressen (d.h. Praxisinteressen) und dem eigenen Nachwuchs (d.h. der Zukunft) zu begründen und zum zweiten kein Schutz der Universitätsinhalte und -strukturen vor Überfüllung, im Gegenteil: programmiertes downsizing der Qualität auf das immer weiter absinkende Niveau einer gerade noch ausreichenden Ausbildung. Die Mechanik war so, daß die Negativeffekte des einen Urteils immer die Negativeffekte des anderen Urteils verstärkten.
Zurück zu den letzten großen Studierendendemonstrationen im Winter 88/89. Die Demonstrationen hatten allen klargemacht, wir stehen vor den Trümmern einer verfehlten Hochschulpolitik. Gnadenlose Unterfinanzierung, Verluderung der Strukturen, chaotisierende Bürokraten. Wenn Sie die Zeitungen dieser Zeit aufschlagen, erfahren Sie noch etwas anderes. Die Regierung Kohl ist am Ende. Der Kanzler regiert seit Jahren nicht mehr. Er sitzt die Probleme aus. Arbeitslosigkeit in Rekordhöhen. Reformstau - vom Staatsbürgerschaftsrecht über das Rentensysem zur Steuerreform, usw., usw. Dies war der Tenor im Winter 88/89.
Aber bevor die Universitäten geschlossen werden, bevor die Regierung Kohl ihren Offenbarungseid leisten mußte, also vor den erwarteten Zusammenbrüchen, bricht die DDR und der Ostblock zusammen. Ende 1988 setzt in der Sowjetunion die Bewegung vom Rubel zum Dollar ein. Es gibt Probleme mit Westkrediten. Den Rest kennen Sie. Die Wiedervereinigung Deutschlands hat alle existierenden Probleme der BRD weggewischt. Vor dem absoluten Elend der Lage in der DDR verblaßten alle Hochschulprobleme. Immerhin, der Streik brachte nochmal etwas Geld in die Universitäten, das Möllemann-Programm, es war das letzte und war in ein paar Jahren verbraucht. Die Hochschulpolitik in der Berliner Republik, die wir seit den letzten großen Studierendenprotesten bis heute erleben, unterscheidet sich in einem Punkt sehr grundsätzlich von der Alt-BRD: sie hat den letzten Realkontakt verloren und kippt in die Simulation. Die Gründe sind vielfältig. Einen will ich zuerst nennen: das Verschwinden der seriösen Berichterstattung über Hochschulen. Für die durch die achtziger Jahre geprägten jungen Journalistinnen und Journalisten ist Bildungspolitik / Hochschulpolitik kein Thema. Die Medien haben sich in den achtziger Jahren von den Hochschulen abgewandt, insbesondere das Fernsehen. Das Berufsfeld Medien wuchs zwar und füllte sich mit Leuten, die aber alles Mögliche ins Programm brachten, nur nicht ihre unterfinanzierte, gebeutelte, häßlich gewordene Universität. Viele junge Leute, die in die Medien gingen, hatten es gar nicht bis zum Ende des Studiums an einer Universität ausgehalten.
In der Mediengesellschaft gilt: wenn die Hochschulen nicht in den Medien interessant gemacht werden, spielen sie öffentlich keine Rolle. Es kommt zu einer Spirale negativer Verstärkerwirkung: weniger Information, weniger Kompetenz, schlechtere Berichterstattung, allgemeiner Informationsschwund als Basis für die Konstruktion von Phantasmen über die Universität. Niemals in der Geschichte war das Wissen, was eine Universität ist, so marginal wie heute. Und die Professoren, die unter Überlast und Unterfinanzierung begraben wurden, erwiesen sich als unfähig, das miese Bild der Unis in den Medien aufzuhellen. Immerhin, in einer gigantischen politischen Anstrengung gelang es den Politikern 1992, sich kurzfristig zu einer Wirklichkeitsfeststellung durchzuringen. 1992 haben die Finanz- und Wissenschaftsminister die Entdeckung gemacht, daß die Hochschulen tatsächlich unterfinanziert sind, nämlich mit drei bis vier Milliarden. Im Zeitalter der Simulation schwindet freilich der Realkontakt schnell wieder. Gestern Abend erklärte unser Minister, Herr von Trotha, im Südwestfunk, die Universitäten seien nicht unterfinanziert (das kann offensichtlich nur an den Stellenstreichungen im Rahmen des Solidarpakts liegen). Dabei kann durchaus zugestimmt werden, daß das beste Elend die baden-württembergischen Hochschulen haben mögen.
Mit der deutschen Hochschulpolitik konnte der beschleunigte Ausgewogenheitsjournalismus der neunziger Jahre ohnehin nichts anfangen. Seriöse Recherchen kosten Zeit und Geld. Außerdem bestand immer wieder die Gefahr, daß die Wirklichkeit ans Licht kommt und die politische Ausgewogenheit, d.h. jede Gruppierung muß apriori gleichermaßen Schuld haben, nicht mehr garantiert ist. Die Medienwelt der Simulation, der Virtualität hergestellter Wirklichkeiten, der Konstruktion von Image, hat ihre eigene Logik. Diese ist nicht unpolitisch, im Gegenteil, sie prägt das Politische. Bestes Beispiel ist die Ruck-Rede des Staatsoberhaupts. Die dort gemachten Anmahnungen paralysieren sich gegenseitig. Wenn man das Schema formalisiert, so kommt dabei heraus: ‘Die Universitäten sollen gelb sein, aber sie sollen nicht gelb sein, sondern blau, aber nicht wirklich blau, sondern rosa. Sie sollen sparen, sich ausbauen, durch Quantität Qualität erzeugen und gleichzeitig durch Qualität die Quantität vermehren. Sie sollen wie Flugzeugträger sein, die als U-Boote brauchbar sind und in denen kleine Elitetruppen in den Orbit transportiert werden können.’ Tony Blair hat nach dieser Manier bekanntlich seinen Wahlkampf gewonnen.
Das Verschwinden des Wissens um die Existenz einer Wirklichkeit, die zu erreichen eine mühevolle Recherchearbeit ist, hat inzwischen vielleicht schon die letzten Bastionen seriöser Hochschulberichterstattung erreicht. Am 21. November ‘97 läßt die Wochenzeitung Die Zeit offensichtlich unredigiert einen Beitrag passieren, in dem der Satz stand: „Wenn ich in Deutschland Steuern zahlen müßte, bestünde ich darauf, daß jemand für 120.000 Mark im Jahr länger als acht Stunden in der Woche arbeitet.“ Wenn sie ältere Zeitungen durchblättern, so stellen Sie fest, daß Hochschullehrer früher Leserbriefe schrieben, wenn falsch über die Unis berichtet wurde. Wollten wir das heute wieder einführen, es wäre ein Full-Time-Job. Glücklicherweise sind wir Freiburger Hochschullehrer schon vor Jahren auf unsere Arbeitszeit und Effizienz von externen Wirtschaftsprüfern evaluiert worden. Das Gutachten hat die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Freiburger Professoren mit schlappen 55 bis 60 Wochenstunden eruiert, um uns anzuhalten unsere Leistungen zu steigern – was viele von uns getan haben, die es auch noch lernen werden, sich dreizuteilen.
Die Hochschulpolitik der neunziger Jahre basiert auf der Logik der Mediengesellschaft. Nach ‘89 erklären die Regierenden erstmal das westdeutsche Hochschulwesen zur blühenden Landschaft, in der sich faule Studierende und faule Professoren räkeln. Genauer gesagt, 1990 bis 1993: vier Jahre Propagandafeldzug gegen die faulen Studenten. 1994 bis 1997: vier Jahre Propagandafeldzug gegen die faulen Professoren. Ich fange mit dem ersten an.
Hieß es in den achtziger Jahren realistisch, junge Leute in Ausbildung und Studium sind für alle besser als Arbeitslosigkeit, so soll jetzt die Studierenden-Durchlaufgeschwindigkeit erhöht werden. 1.12.1989: 23 Kultusministerkonferenzempfehlungen zur Studienzeitverkürzung. Im rasenden Tempo wurden die Empfehlungen in Stuttgart abgeschrieben und gingen am 17. Oktober 1990 (zehn Monate später) an die Universitäten mit der Bitte um Stellungnahme. Ich lese Ihnen jetzt nicht alle 23 Empfehlungen vor. Es handelte sich hier um das Regiebuch für den inzwischen vollends gescheiterten Versuch, durch Steigerung der Regelungsdichte die Universitäten irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich habe im Januar 1991 meine Stellungnahme hierzu an den Dekan geschickt, der sie nach oben weitergeleitet hat. Ich lese das auch nicht ganz vor, sondern nur die wichtigen Passagen:
„Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden nach meiner Auffassung in der angestrebten Hauptsache nichts bewegen. In ihren unbeabsichtigten Nebeneffekten sind sie zum Teil kontraproduktiv. Die Grundhypothesen sind durchgehend kurzsichtig. Unberücksichtigt bleiben: erstens das Schulsystem und zweitens der Arbeitsmarkt als wesentliche Randbedingung und drittens die Sturkturlogik von Wissenproduktion und -vermittlung in universitär autonomisierten Disziplinen.“
Meine Überlegungen zum Schulsystem lasse ich heute weg. Das hörte damals mit der Prognose auf: „Solange sich das reiche Baden-Württemberg den verschwenderischen Luxus leistet, das Schulsystem des 19. Jahrhunderts in allen seinen Dimensionen zu simulieren, werden Studienzeitverkürzungen strukturell behindert. Absehbar ist: wird in der Schulpolitik am Gymnasium und am Abitur festgehalten, werden in den Universitäten über kurz oder lang Mehrheiten für von den Universitäten durchgeführte Eingangsprüfungen entstehen.“
Heute wichtiger und interessanter sind vielleicht die Überlegungen zum Arbeitsmarkt:
„Das Schulsystem ist politisch gestaltbar, nicht so der Arbeitsmarkt in einer freien Gesellschaft. Empfehlung Nr. 18 ist in dieser Hinsicht unsinnig“ (diese Empfehlung lautete ‘Berücksichtigung der Studiendauer bei Einstellungsentscheidungen im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft’; zu diesem Komplex gab es noch eine Empfehlung Nr. 3 ‘laufende Information über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und darüber, daß ein höheres Berufseintrittsalter die Einstellungschancen in der Regel verschlechtert’). Dazu habe ich 1991 kommentiert: „Irreführend ist die laufende Information darüber, daß ein höheres Berufseintrittsalter die Einstellungschancen ‘in der Regel’ verschlechtert. Dies ist eine statistische Konstruktion und keine Realität. Vergleichbar ist dies nur mit Hoffnungen, z.B. durch eine laufende Information, daß bei Unfällen in Chemiefabriken in der Regel keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, eine Steigerung der Grundstückspreise neben solchen Fabriken zu erzielen.“ – Ich habe dann auf Forschungen zur Akademikerarbeislosigkeit hingewiesen und geschrieben:
„Daraus folgt: in Bereichen, in denen attraktive Berufschancen erreichbar sind, verkürzen die Studierenden automatisch ihr Studium, in Bereichen, wo dies nicht der Fall ist, verlängern sie ihr Studium, weil dies in jedem Fall ihrer Karriere weniger schadet als das biographische Loch einer auch noch so kurzfristigen Arbeitslosigkeit oder der Makel ausbildungsinadäquater Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt überhaupt nur eine einzige politische Handlungsmöglichkeit für diese Problematik: die Einführung der Zwangsexmatrikulation. Alle Maßnahmen unterhalb dieser Schwelle sind wirkungslos und häufig kontraproduktiv. Die Einführung der Zwangsexmatrikulation hat die Landesregierung aus guten Gründen nicht im Sinn. Daher werden wir weiterhin, wie in anderen Sektoren des Bildungssystems so auch im Bereich der Universitäten, dort, wo auf dem Arbeitsmarkt eine Flaute ist, mit der Alternative leben: Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung oder Arbeitslosigkeit.“
1991 war das Thema Akademikerarbeitslosigkeit noch im Komplex Studiendauer enthalten. Seitdem ist es Zug um Zug aus der hochschulpolitischen Debatte herausgedrängt. Es wird so getan, als ob der Arbeitsmarkt geradezu begierig auf die viel zu lang Studierenden warte. Wenn heute die Formel Schule macht: „Gute Leute setzen sich immer durch“, so empfehle ich bei denen, die das sagen, biographisch nachzuschauen, ob sie sich überhaupt nennenswert gegen Konkurrenten haben behaupten müssen. Denn wer tatsächlich die Wahrheit von Konkurrenzkämpfen erfahren hat, wird eher sagen: „Ich habe auch Glück gehabt – meine Konkurrenz bestand aus guten Männern oder Frauen“.
Schließlich will ich Ihnen noch aus meiner damaligen Stellungnahme zum Komplex ‘Autonomie universitärer Wissensproduktion und Vermittlung’ vortragen, die die Problemlage dieser Zeit deutlich macht:
„In der Mehrzahl der Empfehlungen wird eine Philosophie erkennbar, der zufolge eine Studienzeitverkürzung durch Druck auf Studenten, Druck auf Hochschullehrer, Verregelung, Kontrolle, Gängelung erreicht werden soll. Diese Philosophie wird scheitern. Der seit zehn bis fünfzehn Jahren zunehmende staatliche Druck auf die Universitäten hat zu keiner Verkürzung der Studienzeit geführt. Jeder Manager, der diese Philosophie zum Ausgang des 20. Jahrhunderts seinen Mitarbeitern auch nur Monate zumutete, wäre längst pleite, weil seine besten Leute bei der Konkurrenz wären.
Keine der Empfehlungen kommt an der Tatsache vorbei, daß der einzige Bereich, in dem inneruniversitär Studienzeit nennenswert verkürzt werden kann, die Lehrinhalte, grundgesetzlich geschützt ist. Daß Grundrechte der Administration Schranken setzen, ist ihr Sinn. Bei den Empfehlungen handelt es sich der Tendenz nach um Einschnürungsempfehlungen, die nicht wirken werden, weil sie ohne Grundrechtsverletzung bzw. hohe politische Kosten nicht sanktionierbar sind.
Darüberhinaus hat man den Eindruck, hier wird ein System von Hürden, Stolpersteinen, Flaschenhälsen empfohlen, das vielleicht geeignet ist, die Studienabbrecherquote von intelligenten, aber durch dieses System entnervten Studenten zu erhöhen. Wie bei Systemen der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten werden diese Regelungen zu einer Verlängerung der Fahrzeiten führen.
An dem wirklichen Problem des Umgangs mit der Explosion des Wissens im 20. Jahrhundert gehen die Empfehlungen schnurstraks vorbei. Wo sich Wissen dramatisch vermehrt, gibt es für die Ausbildung zwei Möglichkeiten, damit umzugehen: erstens Veränderung der Disziplinen durch Ausdifferenzierung oder Bündelung, zweitens Antiquierung von Wissensbeständen. Beides ist sach- und fachgerecht nur im Rahmen von Forschungsaktivitäten zu machen. Kommt die Forschung nicht voran, bleibt es beim Status quo. Je weniger eine Landesregierung Forschungsförderung betreibt, umso längere Studienzeiten erhält sie. Der Gedanke, Lehre oder Studium unabhängig vom sich verändernden Wissens rationalisieren zu wollen, ist widersinnig. Die Tendenz der Empfehlungen geht in Richtung der Verwandlung der Universität in eine überflüssige Klippschule.
Die Landesregierung täte gut daran, sich der Wahrheit zu stellen, daß sie für die Studienzeitverkürzung nicht viel Gutes aber sehr viel Schlechtes bewirken kann. Sie kann die Überlastquote abbauen (Empfehlung Nr. 11) und damit zur Forschung ermuntern, sie kann den personalintensiven Service der Bibliotheken erhöhen (Empfehlung Nr. 12) und sie kann langfristig den ungünstigen Aufbau der Altersstruktur der Hochschullehrer ausgleichen. Alles andere – zweifellos gut gemeinte – der Empfehlung wird nichts oder eine Verlängerung der Studienzeit bewirken.“ (21.01.1991)
Leider hat die Landesregierung die Universitäten weiter chaotisiert. Dank der Widerstandskraft von Rektor, Senat und Fakultäten sind absurde Dinge abgewehrt: Die Landesregierung wollte eine Zeit lang den Studienfachwechsel begrenzen, sie wollte regierungsamtlich die Stoffgebiete der Prüfung detailiert fixieren; sie hat mehrere Jahre die Professoren damit beschäftigt, die Studienordnungen nach Bundesrahmenplänen umzuschreiben, um am Schluß dieser Verschwendung von professoraler Arbeitskraft zu erklären, die Universitäten sollten sich nicht homogenisieren, sondern unterschiedliche konkurrierende Profile ausbilden.
1993 gab es zaghafte Versuche von Seiten der Studierenden zu protestieren. Eine lesenswerte kleine Geschichte der studentischen Politik in Freiburg finden Sie in Heft 1 (1997) von Ras-le-bol (erhältlich im Buchladen Jos Fritz). Diese Versuche waren nicht vergleichbar mit dem Engagement von 1987, schon gar nicht mit dem von heute. Aber der Winter 1992/93 ist wichtig, weil die Regierung den bisher rigorosesten Vorstoß unternommen hatte, die Inhalte der Lehre zu normieren. Es ging um den Erlaß des Ministeriums ‘Straffung des Studiums durch Begrenzung des zeitlichen Gesamtumfangs, der für den erfolgreichen Abschluß erforderlichen Lehrveranstaltungen’. Ich erspare Ihnen eine Verlesung dieses Erlasses des Ministeriums. Wichtig ist, der Erlaß enthielt die Elemente, die über die bisherigen Einflußnahmen der Regierung auf die Lehre hinausgingen. Gefordert wurden nicht mehr nur Regelungen für ein ordnungsgemäßes Studium, sondern Regelungen, die nach dem schulischen Prinzip der Stundentafel bestimmte Lehrinhalte festschrieben und der Genehmigung durch die Regierung unterstellten. Der im Erlaß verwandte Terminus „Studieninhalt“ verdeckte, daß es um Lehrinhalte ging. Die Formulierung „Begrenzung des zeitlichen Gesamtumfanges“ verdeckte, daß eine schulische Vollplanung beabsichtigt war, die in einem dann möglicherweise zweiten Schritt die staatliche Sanktionierung von abweichender Lehre ermöglichen konnte.
Den philosophischen Fakultäten war es in der Vergangenheit mehr oder weniger gelungen, die staatlichen Versuche, Lehrinhalte zu reglementieren, dadurch abzuwehren, daß sie Prüfungsordnungen und Studienpläne vorgelegt hatten, in denen meist nur formale Mindestanforderungen fixiert und Vervollständigungen offen gelassen wurden. Das Instrument der Trennung von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlveranstaltung bot eine Chance, die Lehrinhalte so flexibel zu halten, wie dies der Eigenlogik des wissenschaftlichen Prozesses angemessen ist. Der damalige Erlaß zielte jedoch auf eine inhaltliche Fixierung der Gesamtanforderungen, die jedem Studierenden einen erfolgreichen Abschluß gleichsam garantieren sollten. Und zwar nicht nur im Sinne einer regulativen Idee, sondern als kontrollierbare Tatsache. Mit Regelungen für die „tatsächliche Studierbarkeit“ sollten die innere Struktur sowie Thematiken der Fächer administrativ fixiert werden und Wagnis und Risiko eines Studiums und damit auch die Kontingenz von universitären Lernprozessen abgeschafft werden. Diese neue Tendenz der staatlichen Hochschulpolitik erforderte eine Revision des bisherigen Verhaltensmodus’ der Professoren gegenüber der Landesregierung.
In der Konsequenz begaben sich nun auch die Professoren auf die Ebene der Simulation und setzten sinnvoll aussehende Zahlen in die ministeriellen Kästchen, die jenseits allen Realbezugs des Studiums lagen. Es gelang, den Erlaß auf diese Weise soweit zu unterlaufen und zu entschärfen, daß der größte Schaden für Lehrende und Lernende abgewehrt werden konnte. Denn die bisherigen Festlegungen von Mindestanforderungen und weitergehenden Studienempfehlungen erfolgten unter der Voraussetzung, daß Studierende die volle Zeit einschließlich der vorlesungsfreien Zeit auf das Studium verwenden. Die Wirklichkeit des Studierverhaltens hatte sich an unseren Fakultäten zum Teil gravierend verändert. Wie immer Gründe und Motive beschaffen sein mögen, es wurde unverkennbar, daß ein erheblicher Teil der Studierenden aus Quasi-Erwerbstätigen besteht, die die Universität wie eine Stätte der Erwachsenenbildung nutzen. Dieser Umstand hatte bei den Betroffenen nicht nur die Zeitökonomie, sondern auch die emotionale Bindung an das Fach und die Universität verschoben und die effektive Fähigkeit zur Investition in ein Studium tangiert, das auf akademischer Liberalität basiert. Der Straffungserlaß war von vornherein zum Scheitern verurteilt, da er von der Fiktion eines Vollzeitstudierenden ohne Nebenjobs ausging. Die Unis gaben ihre fiktiven Ziffern ab, und der Minister verkündete einen großen Erfolg in der baden-württembergischen Hochschulpolitik. Welche Seite damals die andere mehr betrogen hat, oder wer den größeren Selbstbetrug zu verbuchen hatte, ist heute schwer feststellbar. Die Studierendenvertreter haben sich damals mit einer bewundernswerten Engelsgeduld in Gremien und Kommissionen in die kafkaeske Welt von Verordnungen, Muß-Kann-Soll-Bestimmungen, in unerträgliche Schaumschlägereinen, kurz: in die heiße Luft der Bürokratie, so eingearbeitet, daß ich befürchte, einige könnten an ihre Seele, gar an ihrem Geiste Schaden genommen haben.
Meine Damen und Herren, ich komme langsam zum Schluß meines Rückblicks nach vorn. Es war dies der letzte größere klassisch-administrative Zugriff auf die Länge der Studienzeiten.
Das Thema faule Studenten trat zurück. Das Thema faule Professoren wurde medienwirksam hochgespielt, wobei insbesondere die Forschung als Faulenzertätigkeit qualifiziert wurde. Da die Arbeitszeit von Professoren in Freiburg durch externe Wirtschaftsprüfer längst evaluiert war, konnten wir gegen die öffentlichen Ressentiments und Fehlinformationen angehen. Auch stellte sich heraus, daß etliche Institute und Seminare Mitte der 90er Jahre eine ganz ordentliche innere Studienreform zum Abschluß gebracht hatten. Dies war in der Regel unbemerkt von Politik und Medien geschehen. Die inhaltlichen Fragen waren auch viel zu komplex, um sie dem herrschenden Typ von Hochschuljournalismus vermitteln zu können.
Vielleicht seit Mitte der 90er Jahre wird die Hochschulpolitik vom neoliberalen Denken erreicht. Die Phase der Simulation neigt sich dem Ende zu. Durch Bürokratie, administrative Scheintätigkeiten, Gängelung und Propaganda-Feldzüge hat sich nichts verbessert. Fortschritte gab es nur da, wo die drei funktionalen Gruppen, Studierende, Assistenten und Professoren, in Seminaren und Instituten kooperierten. Wer die Ahnungslosigkeit und Borniertheit der Regierungen in Sachen Universität zwei Jahrzehnte als Hochschullehrer erlebt hat, den kann es überhaupt nicht schrecken, wenn nun von Wirtschaftlichkeit die Rede ist und wenn der ökonomische Diskurs um sich greift und sein eigenes Rationalitätspotential einbringt.
Auf der Ebene des Geldes vereinfachen sich viele Dinge. Nun geht es sehr konkret um die Frage der Verteilung des Reichtums der Gesellschaft, und damit gibt es keine isolierte Hochschulpolitik mehr. Das Geld, das für Bildung ausgegeben wird, steht für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung.
Was den öffentlichen Reichtum angeht, so stand nicht die Bildung, schon gar nicht die Universitäten, jemals in der Bundesrepublik an der Spitze der Prioritäten. Nach ‘45 wollte man alles andere, nur keinen Geist, ja nichts Hervorragendes, keine geistige Elite. „Bildungsnotstand“ war die Parole Freiburg 1965. In den 70er Jahren reimte sich Universität im Bewußtsein der Bürger auf Weltfremdheit - unnütz der Physiker, der dem mittelständischen Kleinbetrieb kein Patent anbot. Ein baden-württembergischer Ministerpräsident erfand in den 80er Jahren den Terminus „Diskussionswissenschaften“, womit klar war, daß dies eher unten auf die Prioritätenliste gehörte.
Der öffentliche Reichtum der Bundesrepublik kannte drei Großabnehmer: einen sozialdemokratischen, einen christdemokratischen und einen großkoalitionären. Es waren dies für die SPD der Bergbau, für die CDU die Großbauern und für die große Koalition die Beamten. Der Artikel eins des wahren Grundgesetzes dieses Landes lautet: „Der Besitzstand wird gewahrt.“ Meine Damen und Herren, Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß Sie mit Ihren Forderungen diese drei Gruppen angreifen, denn dort werden die Besitzstände gewahrt. Die Beamten können Sie gar nicht für die Bildung zur Kasse bitten, weil Beamte in allen Parlamenten gestützt von Berufstätigen des öffentlichen Dienstes die Mehrheit haben. Hier sitzt die Exekutive in der Legislative. Bleiben die Bereiche, mit denen die politische Klasse der Bundesrepublik unsere Zukunft sichert: die heimischen Kohlevorkommen und der deutsche bäuerliche Großbetrieb in der EG-Planwirtschaft.
Nur einige Krümel der Subventionen aus Steuermitteln, die hier ausgegeben werden, würden reichen, die Universitäten personell so auszustatten, daß sie ihren Auftrag erfüllen können. Aber dies greift die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland an. Und bis Studierende die Aktionsmacht entwickeln, ungestraft die Bonner Bannmeile mit Knüppeln bewaffnet zu durchbrechen, wie die Bergleute vor Jahren - oder bis sie die Präsenz der Bauern erreichen, die, wenn es darauf ankommt, mit ihren Traktoren überall hinfahren, wo sich ein Regierender zeigt, müssen Sie wohl noch ein bischen üben.
Weil aber der öffentliche Reichtum in festen Händen ist, denken nun viele über den privaten Reichtum nach. Auf den Privatkonten der Bundesbürger liegen Billionen fest. Meist ist dieses Geld krisensicher angelegt. Sehr beliebt ist die Immobilie. Ganz wenige Privatleute gibt es, die ihren Reichtum in Risikobereiche investieren. Selbst die Erbschaftswelle, die seit Jahren läuft, führt zu keiner Bereitschaft, irgendetwas mit dem Geld zu unternehmen. Ich weiß, es ist eine arge Zumutung, in diesem unseren Lande laut darüber nachzudenken, ob man nicht eine Immobilie - dieses wahre Symbol unserer politischen Verhältnisse - für eine bessere Ausbildung der Kinder riskieren könnte?? Ob nicht vielleicht die reichen Eltern, wenn die Verteilung des öffentlichen Reichtums blockiert ist, etwas für die Bildung zahlen?? Ob nicht vielleicht, wenn Eltern strukturell benachteiligt sind, die reichen Kinderlosen ihre Immobilie ... ??
Für mich ist der Neoliberalismus weiß Gott nicht das Ziel der Geschichte. Ich denke, er ist eine vorübergehende Chance, das Mikadospiel zu beenden, das diese Gesellschaft seit Anfang der 80er Jahre spielt: Wer sich bewegt, hat verloren.
Ich habe kein Programm zum Schluß; mein Beitrag sollte nur ein Rückblick sein, Informationen geben, aber nach vorn, indem das Gelände von Betrug und Selbstbetrug etwas geräumt wird. Ich danke Ihnen, daß Sie dieses Stück des Vorlesungsmarathons mit mir gelaufen sind.